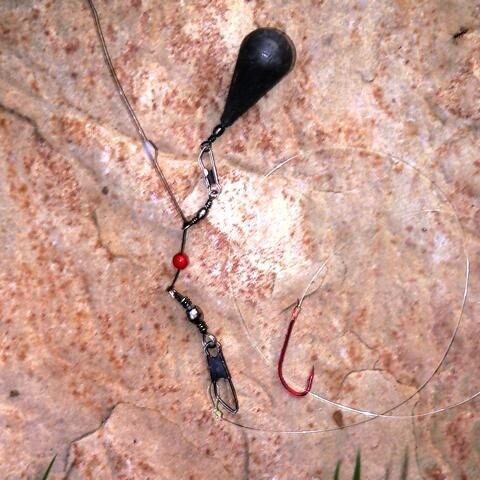Parasiten (z.B. Schwimmblasenwurm)
Durch die Globalisierung und den biologisch unkontrollierten Handel und Transport von Waren und Tieren über viele Tausende Kilometer hinweg werden immer neue Parasiten in Gebiete eingeschleppt, in dehnen sie nie zuvor vordringen konnten. Dadurch sind ganze Tierarten und auch der Mensch immer neuen Gefahren ausgesetzt. Für einige Tierarten und Ökosysteme werden diese fremden Parasiten zur ernsthaften Bedrohung. Der Aal hat sich im laufe der Evolution an einer handvoll Parasiten gewöhnen können und diese bis heute überlebt. Derzeit kommen durch die Globalisierung aber extrem viele und unterschiedliche neue Parasiten hinzu. Zudem wird ihr überleben durch den Klimawandel immer einfacher. Seit der Jahrtausendwende wurde alle 2 Jahre ein neuer Aalparasit in Europa eingeschleppt und die Wissenschaft hat keine Antwort auf die Frage wie das alles weitergehen wird bzw. wo es endet.
Der wohl bekannteste Parasit ist der Schwimmblasenwurm Anguillicola crassus, der durch Import von lebenden Aalen aus Taiwan Anfang der 1980er Jahre in die Weser eingeschleppt wurde. Innerhalb von nur 2 Jahrzehnten breitete sich der Fadenwurm in ganz Europa aus und befiel den europäischen Aalbestand mit verheerenden Folgen.
Dieser Nematode wird im europäischen Aal etwa doppelt so groß wie in seinem ursprünglichen Wirt, der im übrigen mit dem Wurm zurechtkommt. Insgesamt sind durchschnittlich über 70 % des Aalbestandes von diesem Wurm befallen. Regional können jedoch bis zu 90 % des Bestandes (Brandenburg) befallen sein. Bei wiederum ca. 70 % der befallenen Aale richtet der Wurm einen messbaren Schaden an den Schwimmblasenwänden an und bei ca. 10 % der Aale schädigt er die Schwimmblasenwände derart, das sie den Atlantik definitiv nicht mehr überqueren könnten um abzulaichen. Führende Parasitologen sind der Ansicht, dass der Aalbestand auf Grund seines Parasitenbefalls trotz getroffener EU Maßnahmen in naher Zukunft aussterben wird.
Schwimmblasenwürmer vermehren sich innerhalb der Schwimmblase durch Eiablage. Bevor das bis zu 4,5 cm lange Weibchen (größter Wurm in der Schwimmblase) stirbt, legt es bis zu 10.000 Eier in der Schwimmblase ab. Diese werden über eine Verbindung zum Darmtrakt ausgeschieden.
Um sich auszubreiten benötigt der Schwimmblasenwurm jedoch einen Zwischenwirt. Dieser ist als Copüepode (Ruderfußkrebs oder Hüpferling) in allen europäischen Gewässern vorhanden. Sobald ein Hüpferling die Larven des Wurms frisst ist er in der Nahrungskette die für den Aal gefährlich ist. Wird ein befallener Hüpferling von einem Aal gefressen befällt den Aal die Larve direkt. Wird ein befallener Hüpferling von einen anderen Tier gefressen, z.B. Jungfische, Kleinfische, Schnecken, Insekten, … verfällt die Larve in diesem Stapelwirt in ein Ruhestadium. Sobald jedoch ein entsprechender Stapelwirt vom Aal gefressen wird, reaktiviert sich die Larve und befällt den Aal auch auf diesem Wege.
Mögliche Maßnahmen:
- Erhöhung der Finanzmittel für die Forschung, wie seit von Parasitologen gefordert
- Vernichtung oder genetische Immunisierung und anschließender Ersatz der Zwischenwirte. Utopisch und sehr Fraglich???
Krankheiten (z.B. Blumenkohlkrankheit)
Die Blumenkohlkrankheit ist eine Tumorerkrankung des Aals. Sie wird vermutlich durch starke Gewässerschmutzung ausgelöst und ist an blumenkohlartigen blassrosafarbenen Geschwüren überwiegend im Maulbereich von Aalen leicht zu Erkennen. Obwohl diese Geschwüre nicht bösartig sind, können sie einen Aal töten. Denn ohne Behandlung wachsen diese Geschwüre solange, bis der Aal keine Nahrung mehr aufnehmen kann und letztlich verhungert. Am häufigsten kommt diese Krankheit bei jungen Aalen (bis 20 cm) vor und in Flussmündungen vor. In der Elbe waren zeitweise bis zu 5 % der Aale erkrankt.
Mögliche Maßnahmen:
- Aufrechterhaltung und weitere Verbesserung der biologischen Wasserqualität
Seuchen (Aalseuche)
Seuchen sind definitionsgemäß stark ansteckende und epidemieartige Krankheiten innerhalb einer Population. Da die Aalrotseuche eine durch Bakterien ausgelöste Krankheit ist und eine Ansteckung bzw. Übertragung von einem Tier auf ein anderes Tier nicht möglich ist, handelt es sich im Grunde also nicht wirklich um eine Seuche. Da diese Krankheit jedoch ausschließlich den Aal befällt und dies in der Regel gleich massenweise, wird hier dennoch der Begriff verwendet. Die Aalrotseuche wird gelegentlich auch als Süßwasseraalseuche u.ä. bezeichnet. Die Bakterien stammen aus der Familie der Pseumonaden und Aeromonaden (z.B. Aeromonas punctata) und sind in allen Gewässern für den Abbau organischer Substanzen zuständig und kommen auch in allen natürlichen Gewässern zu jeder Zeit vor. Erst bei Wassertemperaturen von über 24 °C kommt es zu einer explosionsartigen Vermehrung dieser Bakterien und bei gleichzeitig stark abfallenden Sauerstoffgehalt zum Ausbruch der Krankheit. Da die Bakterienkonzentration in Grundnähe am höchsten ist und gleichzeitig durch den ringen Sauerstoffgehalt vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden, sind die in Grundnähe lebenden Aale für diese Krankheit sehr anfällig.
Insbesondere bei lange anhaltenden Hitzeperioden und in kleineren Stillgewässern ohne Abwanderungsmöglichkeit kommt es häufig zu sommerlichen Massensterben der Aale. Verdächtig sind alle langsam und träge schwimmenden Aale. Zeichen der Rotseuche sind anfangs rote Punkte im Maul- oder Bauchbereich und später größere rote Flächen (daher der Name), mit Fortschreiten der Krankheit löst sich dann die Haut ab und es entstehen große Löcher im Tierkörper, welche mit Geschwüren umrandet sein können. Diese werden durch das eindringen der Bakterien in die Aalhaut verursacht. Unter normalen Bedingungen schützt die schleimige Aalhaut die Fische sehr gut gegen solche äußeren Einflüsse. Bei großer Hitze und Sauerstoffmangel wird die Schleimschicht der Aale jedoch sehr stark geschädigt. Dadurch gelangen die Bakterien in tiefere Schichten der Aalhaut und beginnen auch dort mit dem Abbau der organischen Substanzen, wofür sie schließlich im Wasser allgemein zuständig sind. Die Bakterien können also nicht zwischen lebenden und toten organischen Substanzen unterscheiden und bauen alle entsprechenden Stoffe ab, mit dehnen sie in Kontakt geraten. Im späteren Verlauf der Krankheit löst sich die Haut ab und die Aale treiben auffällig gekrümmt an der Oberfläche bevor sie sterben.
Eine Behandlung der Aale ist unmöglich. Es gibt keine Therapie und wohl auch keine Forschung auf diesem Gebiet. Tote Aale sollten schnellstmöglich aus dem Gewässer entfernt werden. Die Krankheit selbst ist zwar nicht ansteckend für andere Fische oder den Menschen, aber die toten Aale stellen Infektionsherde dar. Die Bakterien sterben bei Temperaturen über 60 °C ab, was den Verzehr nicht erkannter aber doch infizierter Fische unbedenklich macht. Normalerweise sind durch die Seuche meist ohnehin geschwächte Tiere betroffen. Da in einigen Gebieten aber bis zu 90% der Bestände mit dem Schwimmblasenwurm befallen sind, fällt das Aalsterben bei hohen Temperaturen schnell in der gleichen Größenordnung aus. Regional begrenzt kommt es in fast jedem Jahr zu einem Fischsterben. In heißen und langen Sommern (1976, 1991 und 2003) fielen die Aalsterben extrem stark aus.
Mögliche Maßnahmen:
- Sauerstoffzufuhr bei starkem Sauerstoffmangel und hohen Temperaturen
- Besatzverbot für Gewässer ohne Abwanderungs- bzw. Fluchtmöglichkeit
- Umsiedlung von Aalbeständen aus gefährdeten Gewässern in geeignetere Gewässer
- Schnellstmögliches entfernen toter Aale aus betroffenen Gewässern, da sie als Infektionsherde für andere Fische gefährlich werden können
Views: 14